Das Opernglas - Ausgabe 11/2021 ePaper
Normaler Preis
10,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
10,00 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
ePaper
Print
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
INHALTSVERZEICHNIS
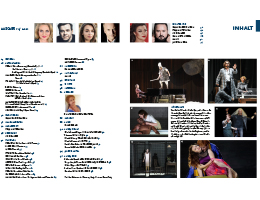
EDITORIAL

EDITORIAL
Autor: Y. Han · Ausgabe 11/2021
Dieser Tage wird sich gern und viel empört, nicht nur in und über Politik oder bei gesellschaftlichen Themen – von denen die manchmal erstaunliche Wut über das Gendersternchen als exemplarisches Beispiel genannt sei –, auch die Kultur ist nicht frei vom grassierenden Klima der Entrüstung auf der einen und der wachsenden Verunsicherung auf der anderen Seite. Auch in dieser Ausgabe tauchen sie in der einen oder anderen Rezension auf: Worte und Fragen wie „das politische Fettnäpfchen“, „die Klippen“, die umschifft werden müssen, „political correct“, „geht das noch in Zeiten von MeToo?“ oder „die große kulturpolitische Diskussion“.
Weiter →
INTERVIEWS

Das Interview: OKKA VON DER DAMERAU – Facherweiterung
Autor: S. Mauß · Ausgabe 11/2021
Brangäne oder Azucena – die großen Mezzopartien waren bisher ihre Domäne. In der Neuproduktion der »Götterdämmerung« an der Deutschen Oper Berlin ist sie aktuell als Waltraute besetzt, während sie für den neuen »Ring« in Stuttgart bereits die Brünnhilde in der »Walküre« vorbereitet. Ein Gespräch über ihre stimmliche Entwicklung ins Hochdramatische.

Vorgestellt: LEA DESANDRE – Zeitgemäße Amazonen
Autor: U. Ehrensberger · Ausgabe 11/2021
Die französisch-italienische Mezzosopranistin ist bei Mozart-Partien und in der Barock-Musik zu Hause, kann William Christie und Cecilia Bartoli zu ihren Förderern zählen. Ihr neues Album kommt naturverbunden und ohne Plastik-Cover.

Im Gespräch: GIANANDREA NOSEDA – Kein Zurück vom „Ring“
Autor: Th. Baltensweiler · Ausgabe 11/2021
Der neue Zürcher GMD Gianandrea Noseda wählt mit »Il Trovatore« die Sängeroper par excellence als Einstand und beginnt diese Spielzeit seine erste Auseinandersetzung mit dem monumentalsten aller Werke des Musiktheaters: dem »Ring des Nibelungen« – Gesprächsstoff genug also.

Im Blickpunkt: HUI HE – 100 x Tosca
Autor: Y. Han · Ausgabe 11/2021
Am 2. Oktober hat die chinesische Sopranistin Hui He die magische Grenze der 100. Vorstellung in einer Partie geknackt – nach der Aida und der Cio-Cio-San hat sie nun auch als Tosca die Dreistelligkeit erreicht. Ein Gespräch über den Stellenwert, den diese Partie in ihrem an italienischen Rollen reichen Repertoire einnimmt.

Nachgefragt: BENJAMIN BERNHEIM – Wohin die Stimme führt
Autor: Y. Han · Ausgabe 11/2021
Erst im September hatte er seinen ganz großen Auftritt an der Hamburgischen Staatsoper: Das Rollendebüt als Hoffmann in Jacques Offenbachs »Les Contes d’Hoffmann«. Über diese komplexe Traumrolle und die Höhen und Tiefen seines Sängerlebens sprach der französische Tenor in der Hansestadt.

Il Pirata: JAVIER CAMARENA – Absurd hohe Töne
Autor: Y. Han · Ausgabe 11/2021
Gerade ist eine neue Studioaufnahme von Vincenzo Bellinis recht selten gespielter Oper »Il Pirata« herausgekommen. Auf der Bühne bekommt man diese Oper nicht oft zu sehen, zumindest nicht in szenischen Produktionen. Liegt es daran, dass es schwer ist, eine adäquate Besetzung zusammenzubekommen?
AUFFÜHRUNGEN

ZÜRICH Salome
12. September ∙ Opernhaus · Autor: Th. Baltensweiler · Ausgabe 11/2021
Das Orchester zeigt sich von seiner allerbesten Seite, und auch sängerisch muss man von einem außergewöhnlichen Abend sprechen. Die vier Hauptpartien sind allesamt überzeugend, in einzelnen Aspekten gar spektakulär besetzt.

BERLIN Götterdämmerung
17. Oktober ∙ Deutsche Oper · Autor: M. Lehnert · Ausgabe 11/2021
Die Deutsche Oper Berlin startete mit einem musikalischen Paukenschlag in den Premierenreigen der neuen Spielzeit: Erstmals wieder vor voll besetztem Haus ging die »Götterdämmerung« über die Bühne. Die Sänger rissen es heraus: Das Großprojekt »Ring« an der Deutschen Oper krankt an einer zu läppischen Inszenierung, ist dafür weitgehend gut besetzt.

HAMBURG Die Entführung aus dem Serail
17. Oktober ∙ Staatsoper ∙ Autor: Y. Han · Ausgabe 11/2021
Hätten Sie gemerkt, dass diese »Entführung« innerhalb von gerade einmal zwei Wochen aus dem Boden gestampft worden war, wenn Sie es vorher nicht gewusst hätten? David Bösch ist es gelungen, einen entstaubten und äußerst kurzweiligen Abend zu kreieren.

LONDON Jenufa
28. September ∙ Royal Opera House ∙ Autor: A. Blanco-Bazán · Ausgabe 11/2021
Nach zwanzig Jahren Abwesenheit kehrte Leoš Janáčeks »Jenufa« in einer Neuinszenierung an das Royal Opera House zurück. Nachdem sie bei den letzten Aufführungen der Oper an Covent Garden die Titelrolle gesungen hatte, war Karita Mattila dieses Mal die Kostelnicka.

DRESDEN Norma
2. Oktober · Semperoper · Autor: M. O‘Neill · Ausgabe 11/2021
Bellinis Belcanto-Meisterwerk »Norma« feierte seine längst fällige Rückkehr auf die Bühne der Semperoper nach mehr als 100 Jahren (sieht man von einer konzertanten Aufführung ab) in einer Neuinszenierung von Peter Konwitschny. So bedauerlich es war, dass das Regie-Konzept oft im Widerspruch zur Intensität und Leidenschaft der musikalischen Leistung von Sängern und Orchester stand, die Musizierenden retteten den Abend.

WIESBADEN Il Trovatore
19. September · Hessisches Staatstheater · Autor: J.-M. Wienecke · Ausgabe 1/2021
Mit Vesselina Kasarova bot das Staatstheater einen klangvollen Namen für eine der zentralen Partien der Oper auf. Die bulgarische Mezzosopranistin eroberte sich mit dem Debüt als Azucena ein für sie bisher noch ungewohntes Fach.

MUSIKFESTSPIELE KÖNIGSWINKEL FÜSSEN Tristan und Isolde
29. September · Festspielhaus Neuschwanstein · Autor: W. Kutzschbach · Ausgabe 11/2021
Das bis jetzt vor allem durch Musicalproduktionen, insbesondere jenes über Ludwig II., König von Bayern, bekannte Festspielhaus am Ufer des Forggensees in Füssen und gegenüber dem Schloss Neuschwanstein gelegen, verlangte mit seinem Bezug zu Ludwig II. und Richard Wagner direkt nach Aufführungen des Komponisten. Mit zweimal »Tristan und Isolde« mit Robert Dean Smith und Catherine Foster, einem Festkonzert mit Werken von Franz Liszt, Sergei Rachmaninoff und Anton Bruckner sowie einem Wesendonck-Liederabend fanden nun erstmals Festspiele statt, und es sollen nicht die letzten sein.

BREMERHAVEN Les Contes d’Hoffmann
25. September · Stadttheater · Autor: M. Wilks · Ausgabe 11/2021
Keine pandemiebedingte Sparversion, sondern (fast) ganz normale große Oper mit Orchester, Chor und einem sehr guten Gesangsensemble – das ist der Bremerhavener »Hoffmann«. Der an den Ort seines ersten Festengagements zurückkehrende, inzwischen international erfolgreiche Tenor Mirko Roschkowski sang die Titelpartie so klangschon und souverän, wie man es auch an deutlich größeren Häusern selten zu hören bekommt.
SPECIALS / INFO

NAMEN UND DATEN
Marina Rebeka singt im November in einer Neuproduktion die Leonora in »Il Trovatore« am Opernhaus Zürich und wird dann als Solistin im „Christmas in Vienna“-Konzert – begleitet vom ORF-Radio Symphonieorchester unter Sascha Götzel, zu erleben sein (17., 18.12.).
Darüber hinaus singt sie im Dezember im Palau de les Arts Reina Sofía die Cio-Cio-San in »Madama Butterfly«, bevor es im Februar für die in Riga geborene Sopranistin weitergeht an die Mailänder Scala in der Titelpartie der Thaïs aus Massenets gleichnamiger Oper.

NACHRUF
Über vier Jahrzehnte hat Karan Armstrong die Deutsche Oper Berlin mit geprägt und sang dort an mehr als 400 Abenden in 24 verschieden Partien. Geboren wurde sie in Havre, im US-Bundesstaat Montana, studierte erst Klavier, dann Gesang bei der legendären deutschen Sopranistin Lotte Lehmann, debütierte als Musetta (»La Bohème«) an der San Francisco Opera (1965) und war danach an der Metropolitan Opera und New York City Opera beschäftigt. 1974 folgte als Micaëla (»Carmen«) ihr Europa-Debüt an der Opéra du Rhin in Straßburg und ein Jahr später am selben Haus als Salome in Strauss’ gleichnamiger Oper, mit der sie europaweit Aufmerksamkeit auf sich zog. 1978 lernte sie bei einer Inszenierung den Regisseur und ihren späteren Ehemann Götz Friedrich kennen, dem sie drei Jahre später an die Deutsche Oper Berlin folgte. Bei den Bayreuther Festspielen debütierte sie 1979 unter seiner Regie als Elsa in »Lohengrin«. Ihr Repertoire beschränkte sich nicht nur auf Strauss und Wagner, sondern auch auf Opern von Komponisten wie Alban Berg, Korngold, Poulenc, Schostakowitsch und Kurt Weill. In den späteren Jahren ihrer Bühnenkarriere brachte es ihr den Titel der „Diva der Moderne“ ein, dass sie zahlreiche Opernuraufführungen als Protagonistin mitgestaltete. Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes verabschiedete sie sich 2001 mit der Rolle der Marschallin in Strauss’ »Rosenkavalier« von der Bühne der Deutschen Oper. Die Sopranistin ist am 28. September 2021 im Alter von 79 Jahren im spanischen Marbella verstorben.

ABSCHIED
Zum Tode der großen Edita Gruberova. Von Jörg-Michael Wienecke.
Ein guter Freund überbrachte die traurige Mitteilung am Abend des 18. Oktober. Ich schreibe diese Zeilen als bescheidenen Versuch eines persönlichen Nachrufs, ganz spontan und tief berührt, mit leisen Tränen in den Augen.
Irgendwie, ganz tief im Innern, hatte man schon immer Bedenken, ob und vor allem wie es für diese große Künstlerin ein Leben post scenum geben könnte. Die Bühne war ihre Welt, Zentrum und Lebenselixier. Dort zog sie alle Aufmerksamkeit wie in einem Brennglas auf sich, war sie über lange Jahre ein rarer, dafür umso heller leuchtender Fixstern am Firmament des Belcanto. Mit einer ganz eigenen, unverwechselbar einmaligen Art, ihr Publikum in den Bann zu ziehen und zu verzaubern.
Keine wie sie vermochte in vergleichbarer Form mit den Tönen zu spielen, den Furor ihrer stupenden Technik quasi zu instrumentalisieren. Keine wie sie beherrschte die Koketterie im musikalischen Vortrag, verführte ein Publikum auf derart entwaffnende Art und Weise mit der hohen Kunst ihres Gesangs, auf dessen Flügeln sie schwebte. Gefragt war ihre Kunst in aller Welt. Sie sang mit den ganz Großen, etwa an der Seite von Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und Alfredo Kraus bis hin zu den namhaften Stars der Gegenwart. Als persönliche Höhepunkte schwärmte sie von der »Traviata« unter Carlos Kleiber an der MET und in München.
Neben ihrem Stammhaus in Wien, an das sie bis zuletzt bevorzugt zurückkehrte, entwickelte sich die Bayerische Staatsoper schnell zu ihrer zweiten großen Liebe und künstlerischen Heimat. Dort feierte sie, vom Publikum heiß geliebt und verehrt, in insgesamt 308 Vorstellungen immer wieder neue Triumphe. Die Elisabetta in einer fesselnden »Roberto Devereux«-Produktion sollte dann am 27.3.2019 bei ihrem 54. Auftritt in der Rolle auch den Schlusspunkt im Rahmen einer szenischen Münchner Opernaufführung setzen. Unvergessen bleibt, wie sie als englische Königin darin final die Perücke zog, im Bette-Davis-Look endgültig dem Wahn verfiel und dadurch ein bebendes Haus in Raserei versetzte. Sie blieb bis zuletzt eine Primadonna assoluta, vor der ich mich in großer Dankbarkeit für das bleibende Geschenk wunderbarer Jahre vollendeter Opernkunst verneige.
AUDIO

OHNE GESANG
Die Konzentration auf sängerische Qualitäten oder Eigenarten lenkt nur allzu oft auch ab von der Substanz und Originalität der eigentlichen Musik. Mitunter ist es auch recht erholsam, Opern- und Liedkompositionen einmal ohne Gesang zu lauschen. Man spürt den speziellen Stilen und Melodien der einzelnen Komponisten genauer nach, wenn sie von Instrumenten dargeboten werden. Aktuell sind einige spannende CDs erschienen, die alle Lust auf mehr machen, in die Jahreszeit passen und auf anspruchsvolle Art unterhalten.
Mit Harfenmusik beispielsweise. Die Harfenistin der Wiener Philharmoniker Anneleen Lenaerts erklärt, dass erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts für „ihr“ Instrument das Doppelpedalsystem entwickelt worden ist, welches das chromatische Spiel ermöglicht und auch eine ganze Reihe von bedeutenden Harfenisten animiert hat, Fantasien über berühmte sinfonische Themen oder solche aus Opern zu schreiben.
Eine ganz eigene Wirkung haben auch die Balladen von Carl Loewe (1796 – 1869), wenn Sie von der Orgel vorgetragen werden, und der im Jahr 1939 geborene Komponist Franz Hummel hat drei Arien aus Ludwig van Beethovens »Fidelio« für Violine und Orchester arrangiert und sorgt spätestens im Allegro von Florestans Kerkerarie für Begeisterung.

AUDIO / SOLO
Fulminant wie Aleksandra Kurzak auch heute noch die Königin der Nacht sphärisch in metallisch gestochene Koloraturen meißelt. Im Februar dieses Jahres hat sie in Wien ein Mozart-Album mit dem Titel „Mozart Concertante“ aufgenommen, das mit der Rachearie grandios startet und in lyrischeren Gefilden aus der Jugendoper »Mitridate, re di Ponto« stilsicher voranschreitet. Man merkt allen Künstlern die Frische und Lust am gemeinsamen Mozart musizieren an und darf sich an der instrumental und vor allem in der Höhe wunderschön leuchtenden Sopranstimme Kurzaks freuen. Dass sie auch dramatisch kann, wird in der tiefliegenden Vitellia-Szene aus dem Spätwerk »La clemenza di Tito« eindrucksvoll markiert, wie ohnehin dieses Album kein brav langweiliges Produkt ist, sondern eine ausgereifte persönlichkeitsstarke Stimme präsentiert.
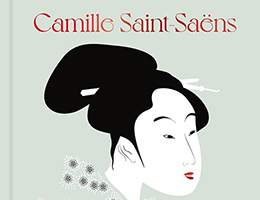
AUDIO / GESAMT
Wenn sich im Dezember dieses Jahres der Todestag von Charles Camille Saint-Saëns zum 100. Mal jährt, hat das ambitionierte Label Bru Zane (die mit den Büchern) bereits drei seiner unbekannten Opern eingespielt. »Samson und Dalila« sind jedem Opernliebhaber ein Begriff, Insider schätzen noch den hin und wieder einmal anzutreffenden »Henri VIII«, aber »Proserpine«, »Le timbre d’argent« oder »Les barbares« sind erst durch die Initiative, die sich so ausschließlich um seltene französische Opern und Operetten bemüht, wieder zum akustischen Leben erweckt worden. Nun also das verträumte Erstlingswerk »La Princesse Jaune« des Komponisten aus dem Jahre 1872, eine angedeutete japanische Kolorierung des auf Exotisches so versiert spezialisierten Multitalents und Kosmopoliten Saint-Saëns: Ein junger Niederländer fantasiert sich von Drogen inspiriert in eine asiatische Welt samt Prinzessin, aus der er durch die wahre Liebe wieder zurückgeführt wird.
Fotos diese Seite © Pauly, Boll, Benhamou, Rittershaus, Jia, Uhlig, Landsberg, Olah, Leclaire, Kenton, Sandelmann, Forster, Musikfestspiele Königswinkel, Hösl, Kalaena, Blajczyk


